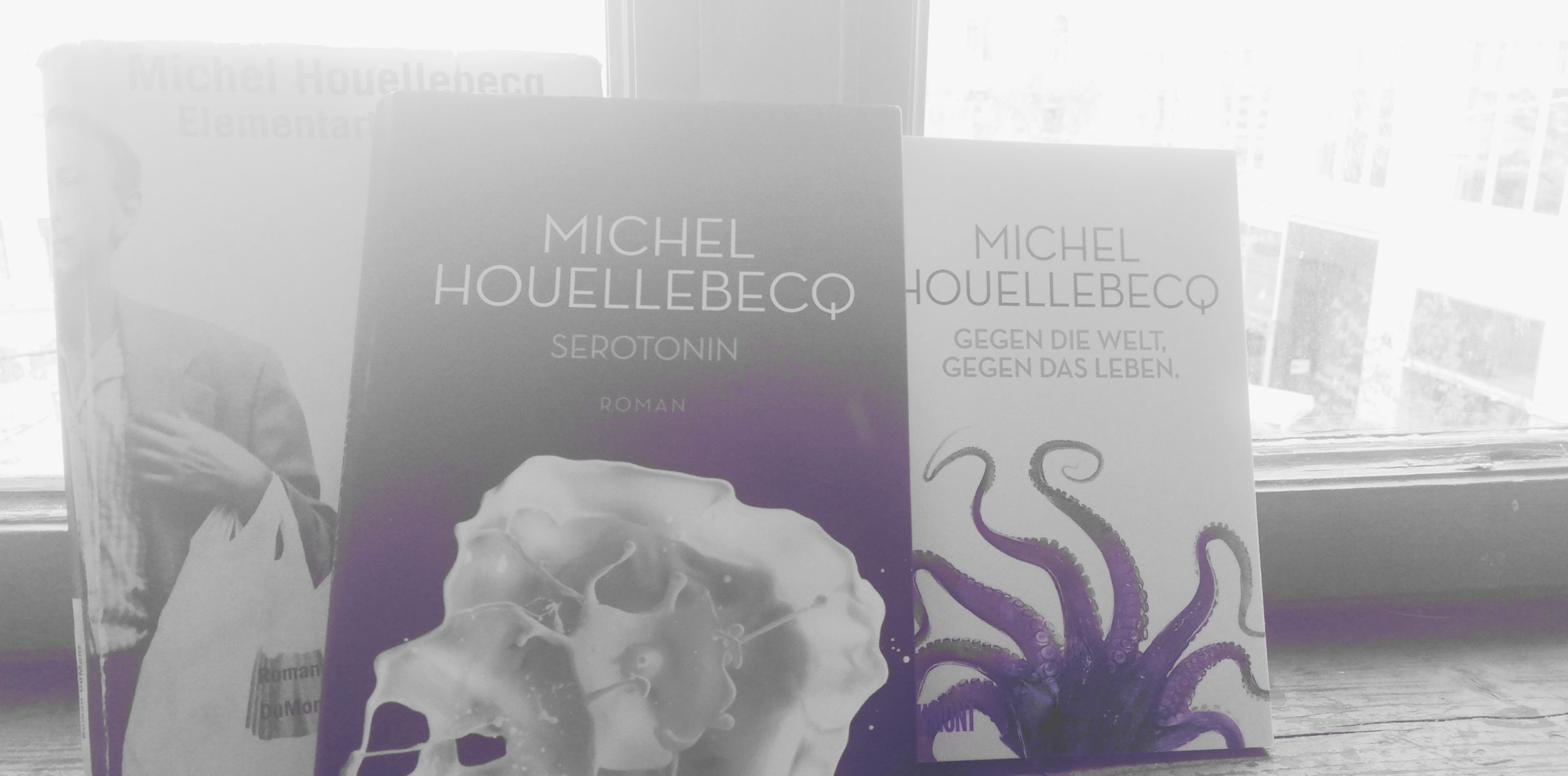
Aus dem Tagebuch eines Buchlesers
30. Oktober 2020
Liest man die schlechten Bücher von Michel Houellebecq ein zweites Mal, werden sie etwas weniger schlecht. Daumen mal Pi kann man davon ausgehen, dass etwa jedes zweite seiner Bücher nicht so erfreulich ist wie das davor, den Unterschied machte hier Unterwerfung, das auf das formidable, herrlich schlaffe Karte und Gebiet folgte. Wenn man es genauer wissen will, dann ist die gültige Reihung die folgende:
Les succès
Lanzarote
Karte und Gebiet
Elementarteilchen
Ausweitung der Kampfzone
Unterwerfung
Les déceptions
Plattform
Serotonin
Die Möglichkeit einer Insel
Wobei festzuhalten ist, dass die Möglichkeit einer Insel das wirklich Schlechteste seiner Bücher ist. Ich konnte es bis heute nicht zur Gänze fertiglesen, aber keine noch so gute zweite Hälfte kann die zähe Brühe wieder wettmachen, davon gehe ich aus. Weiters ist festzuhalten, dass wer wirklich Zugang zu Michel Houellebecqs Oeuvre finden will, nicht am Film Die Entführung des Michel Houellebecq vorbeikommt, den er – Twist! – allerdings nicht selbst geschrieben hat. Dennoch, wie er (Houellebecq spielt sich selbst) seine Kidnapper-Familie mit seinen Ticks und Nervigkeiten in den Wahnsinn treibt, ist berührend. Ästhetisch eine Mischung aus alberner Gerard Depardieu/Pierre-Richard-Klamotte mit ein bisschen Slice-of-Life rauchender trauriger französischer Intellektueller. Ein gelungener Spaß!
Die Möglichkeit einer Insel ist also wirklich misslungen, Plattform nicht sehr, es ist nur eben nicht besonders gelungen, bleibt unter seinen Möglichkeiten und verblasst gegenüber den anderen Romanen. Der interessanteste Fehltritt ist zweifelsfrei Serotonin. Um etwa 150 Seiten gekürzt könnte es ein schöner schmaler tieftrauriger Roman sein, aber so ist er überfüllt mit Michel Houellebecq-Bloatware, die die Geschichte mit unnötigen Versatzstücken anreichert, wohl im Glauben, dass sich der oder die typische Leser/-in sich das wohl so erwartet. Yuzu, die japanische Freundin, sei hier erwähnt, die unnötig parodistisch überzeichnet wird. Als bloßer Gag ist mir die Entlarvung, dass sie mit einem Hund sexuell zugange ist und sich dabei filmen lässt, zu schrill. Wenn hätte Houellebecq das ernstnehmen sollen und der Sache auf den Grund gehen. Warum lässt Yuzu das mit sich machen, warum erregt sie das, wie fühlt es sich an, wie geht es dem Hund dabei, danach? Das hätte ich doch gerne gewusst. Und auch der Protagonist Florent-Claude Labrouste ist ein Widerling, ein Ungustl, ein Arsch, den man sich schwer schön reden kann. Da hatte Houellebecq bereits andere Kaliber am Start.
Im Großen und Ganzen bin ich mit dem Hauptwerk durch, langsam komme ich zu den Neben- und Randwerken, zB.: Gegen die Welt, gegen das Leben – Houellebecqs wieder aufgelegte Erstveröffentlichung.
Im Vorwort zur Wiederveröffentlichung im Jahr 1998 schreibt Houellebecq, dass es sich hierbei ja eigentlich um einen Roman handelt, nur mit einer realen Person als Hauptcharakter. Netter Versuch! Natürlich ist es das ganz und gar nicht. Die Aussage bestätigt nur wiederum, wie schwer es alles, was nicht ein Roman ist, im Literaturbetrieb hat, sodass man zu allerhand Schlangenöl-Verkaufstricks greift, um das Unromanhafte zu verkleiden (siehe auch Daniel Kehlmanns Kurzgeschichtenbuch Ruhm, das als Roman in neun Geschichten untertitelt wurde).
Gegen die Welt, gegen das Leben liest sich wie eine lakonische gut geschrieben Studienarbeit über H.P. Lovecraft mit vielen, vielen Originalzitaten, um den Text auf die vorgeschriebene Textlänge zu strecken. Es beginnt recht akademisch, erst in der zweiten Hälfte, wenn es um Lovecrafts gescheiterte Ehe und seine rassistische Ader geht, nimmt das Buch Fahrt auf.
Es ist schön zu sehen, wie sehr sich Houellebecq über etwas freuen kann bzw. früher freuen konnte, aber dennoch fragte ich mich wieder (und obwohl ich zeitgleich Lovecrafts Ruf von Chtuluh parallel gelesen hatte): Worum geht es hier bei diesem ganzen Flaum? Ich verstehe wohl die äußeren Aspekte, die das Werk so einzigartig machen (wie die Fortführung der Chtuluh-Welt durch andere Schriftsteller), aber die Geschichten selbst, die lesen sich so blaß heutzutage und ich möchte ja nicht zum Method Leser werden müssen und mich etwa als einen Briten in den 20er Jahren des vorigen Jahrhunderts vorstellen, der die Geschichte zum ersten Mal liest. Nein, es erschließt sich mir nicht. Ich kann den Wahnsinn nicht riechen. Mir fehlt der Edelcamp, das Liköraroma eines Vincent Price: Die bebende Wimper, das Zucken eines bestgescherten Oberlippenbartes, das vermisse ich.
Apropos, bevor sich Vincent Price der Theatergruppe Mercury Theatre von Orson Welles anschloss, hatte er bereits Bühnenerfahrung gemacht. Während seines Studiums in Frankfurt und Nürnberg (im Zuge einer Doktorarbeit über Albrecht Dürer) verdingte er sich an der Frankfurter Oper in einer Funktion als Alb der Oper. Der Operndirektor und Generalmusikintendant Bruno Vondenhoff war nämlich der Meinung, dass Tenöre dann am Besten sängen, wenn sie von Furcht durchdrungen waren. Der mit seinen 1 Meter 93 dafür prädestinierte Vincent Price hatte die Aufgabe, die Tenöre während der Aufführung bis aufs Blut zu erschrecken. Jeden Abend bekam er eine neue Verkleidung genäht, mit der er sich in den Schatten des Bühnenbilds gut verstecken konnte. Als Medusa in der Küchenlade, als todtrauriger Baum, als Wolf, dem die Vorderbeine gebrochen waren. Dann kroch er in den kurzen Umbaubausen immer näher an den Sänger heran. Dem schwante schon Übles, froschleichgroße Schweißperlen standen ihm auf der Stirn, ein Zittern da stürzte sich Vincent Price mit einem Geheul aus dem Nichts und verbiss sich in dessen Wade, bis die sich aufblähte, dabei schwarz anlief und der Tenor im Finstern Schreie rief.
Mehr lesen von Peter Waldeck:
Triumph des Scheiterns
von Peter Waldeck
256 Seiten, gebunden mit Schutzumschlag,
Fadenheftung, Leseband
€ 24.00
ISBN 978-3-903184-42-8
Erhältlich in einer Buchhandlung in Ihrer Nähe
